

Reptilien und Amphibien gehören zu den wechselwarmen Tieren und können ihre Körpertemperatur nicht selbstständig regulieren. Sie sind also abhängig von den Außentemperaturen. Sowohl Muskelfunktionen als auch ihr gesamter Metabolismus werden durch die Klimaverhältnisse beeinflusst. Im Gegensatz zu warmblütigen Säugetieren und Vögeln kommen diese Ektothermen mit geringen Futtermengen aus, da sie keinen enormen Energieaufwand betreiben müssen, um ihre Körpertemperatur auf einem konstant hohen Niveau zu halten.
Sinken die Außentemperaturen jedoch unter einen bestimmten Wert, so verfallen diese Poikilothermen in eine Kälte- oder Winterstarre. Die notwendige Betriebstemperatur unterscheidet sich artspezifisch, aber eines haben sie gemeinsam: sie genießen ausgiebiges Sonnenbaden. Die Wärme benötigen sie für ihren gesamten Stoffwechsel, insbesondere die Verdauung, während das UV-Licht durch Aktivierung des Vitamin D für einen gesunden Knochenbau sorgt.
Aus diesem Grund sind ein Großteil der Reptilien vor allem in warmen Habitaten aufzufinden, wie zum Beispiel in Tarifa, die südlichst gelegene Stadt auf dem europäischen Festland. Hier fallen die Temperaturen in den Winternächten kaum unter 10 Grad und somit besteht keine Bedrohung für diese wechselwarmen Tiere.
Während unserer Forschungsreise in Andalusien wurden wir von einem einheimischen Experten für Herpetologie, Francisco Jiménez Cazalla, begleitet. Dieser führte uns zu seinen sogenannten „Hot Spots“, welche normalerweise für Touristen unzugänglich, beziehungsweise unauffindbar sind.
Amphibien
Sämtliche Amphibienarten sind auf Süßwasser angewiesen, da sie ihr Larvenstadium unter Wasser verbringen. Demzufolge ist eine Metamorphose ohne Wasser unmöglich, auch wenn sie als erwachsene Tiere teilweise terrestrische Habitate bewohnen.
Ihr Lebensraum erstreckt sich von den tropischen bis hin zu den kalt-gemäßigten Klimazonen und sie sind abgesehen von der Antarktis auf jedem Kontinent anzutreffen.
In Europa unterscheidet man derzeit fünf Laubfroscharten, darunter den Mittelmeer-Laubfrosch (Hyla meridionalis) von welchem wir in den höher gelegenen Feuchtgebieten Bolonias ein juveniles Exemplar gefunden haben.
Dem Bundesnaturschutzgesetz nach gilt diese Froschart als streng geschützt, wobei er von der IUCN als ungefährdet eingestuft wird. Durch zivilisatorische Faktoren wie Lebensraumzerstörung und das Einsetzen von Pestiziden, besteht jedoch zumindest regional eine große Bedrohung für ganze Populationen. Immer wieder stoßen Biologen auf zahlreiche vergiftete Exemplare.
Zu den Highlights unserer Reise gehörte zweifelsohne das Auffinden eines sub-adulten Europäischen Chamäleons (Chamaeleo chamaeleon). In einer höher gelegenen Region im Nordwesten Bolonias wurde unsere stundenlange intensive Suche nach diesem Kaltblüter schlussendlich belohnt.
Chamäleons brauchen nur sehr geringe Wassermengen, welche durch die Futteraufnahme meist schon ausreichen. Daher benötigen sie keine Gewässer in ihrer Nähe und fühlen sich auch in äußerst trockenen Biotopen wohl.
Die Echten Chamäleons sind Busch- und Baumbewohner. Mit ihren zangenartigen Greiffüßen und ihrem Greifschwanz sind sie dem Leben in der Höhe angepasst. Den Boden betreten sie nur, um den Strauch zu wechseln oder um eine geeignete Stelle zur Eiablage zu finden. Mit einer wippenden Vor- und Rückwärtsbewegung imitieren sie in der Luft wiegende Pflanzenteile und lösen scheinbar ihren Körperumriss auf und verschmelzen regelrecht mit dem gleich gefärbten Hintergrund. Dies ist nicht nur eine ideale Versteckmöglichkeit, die sie vor Feinden schützt, sondern erlaubt diesen Lauerjägern ebenfalls einen garantierten Beutefang.
Der Farbwechsel dient den Chamäleons in erster Linie als Kommunikationsmöglichkeit mit Artgenossen, aber auch als Thermoregulation. Allerdings gehört das Europäische Chamäleon jedoch zu den wenigen Chamäelons, die den Farbwechsel bewusst zur Tarnung nutzen können. Sie sind tatsächlich fähig ihre Färbung dem Hintergrund anzupassen, was den uns in der Terraristik bekannten Tieren wie beispielsweise dem Jemenchamäleon und dem Panterchamäleon nicht möglich ist.
Den etwa 5 cm großen, hell-grünen Winzling erkennt man an den dunklen, kurzen Streifen, die sich beidseitig von den Nasenlöchern über das Trommelfell bis hin zu den Vorderbeinen erstrecken. Die Bauchseite ist hell gefärbt. Da die Temperaturen Südspaniens ziemlich hoch liegen, verzichtet diese Art meist auf ihre Winterruhe. Die Fortpflanzung erfolgt zwischen Dezember und Januar, weshalb die jungen, entwickelten Frösche erst in den Sommermonaten, Juni bis Juli, das Wasser verlassen und sich an Land wagen. In ihr Beuteschema fallen vor allem Insekten, Insektenlarven und diverse Spinnentiere.
Die Europäische Sumpfschildkröte (Emys orbicularis) ist in weiten Teilen Europas verbreitet und zeigt je nach Gebiet regionale Varianten auf, besonders was die Größe der Tiere anbelangt. Während sich Jungtiere sowohl von pflanzlicher als auch von tierischer Kost ernähren, fressen adulte Tiere ausschließlich kleinere Lebewesen wie Insekten, Kleinkrebse, Wasserschnecken, kranke Fische, Aas, sowie diverse Amphibien und deren Larven.
Zu unserer Überraschung sind wir an einem kleinen Teich auf einen Frosch gestoßen, der dem Seefrosch (Rana ridibunda) sehr nahe kommt. Hierbei handelt es sich um eine Froschart, die wir eigentlich in einem solch südeuropäischen Gebiet nicht antreffen dürften.
Er lebt dort zusammen mit den einheimischen Wasserfröschen.
In letzter Zeit blieb nicht unbemerkt, dass der in Mitteleuropa ansässige Seefrosch sich vermehrt zu verbreiten scheint und sich ebenfalls in den südlichen Regionen wohl fühlt. Ob wir hier wirklich ein solches Exemplar gefunden hatten, konnten wir jedoch auf Grund der starken Ähnlichkeit nicht mit Sicherheit behaupten.
Zudem kommt, dass die verschiedenen Wasserfroscharten eigentlich alle aus diversen Hybriden entstanden sind, eine Tatsache, welche die Unterscheidung bei einigen Tieren nicht leichter macht. Der Teichfrosch, welcher die Gewässer Mitteleuropas bewohnt, ist eigentlich nichts anderes als eine Bastardform, welche auf eine Kreuzung zwischen dem Kleinem Wasserfrosch (Rana lessonae) und dem Seefrosch (Rana ridibunda) zurückzuführen ist. Hinzu kommt, dass es sich bei dem Iberischen Wasserfrosch (Rana perezi), welcher in Südspanien verbreitet ist, um nichts anderes als eine Hybridform des Seefrosches (Rana ridibunda) und einer anderen Wasserfroschart handelt.
Süßwasserschildkröten
Neben den nordamerikanischen Schmuckschildkröten, welche immer wieder von gewissenlosen Haltern ausgesetzt werden, leben auch einige einheimische Arten auf der Iberischen Halbinsel.
In den wenigen Tagen, die wir in Andalusien verbracht haben, sind wir gleich auf zwei autochthone Arten gestoßen. Für die in der Natur lebenden Exemplare zählen wir Menschen zu den größten Feinden überhaupt. Daher ist es auch nicht verwunderlich, dass diese tagaktiven Echsen sich sofort ins Wasser fallen lassen, wenn sie einen Menschen sehen. Aus diesem Grund war es leider nicht immer einfach, die Tiere über längere Zeit hinweg zu beobachten und sicher bestimmen zu können.
Die Maurische Bachschildkröte (Mauremys leprosa) ist fast überall in den Gewässern Südspaniens anzutreffen. Vor allem in den tiefer gelegenen, vegetationsreichen, warmen, langsam fließenden oder stehenden Gewässern fühlen sie sich wohl. Wie die meisten Wasser-schildkröten nehmen sie sowohl vegetarische als auch animalische Kost zu sich. Sind die klimatischen Verhältnisse schlecht, vergraben sie sich zu einer kurzen Winterruhe im Bodenschlamm ihres Biotops.
Schildkröten bevölkern unseren Planeten seit mehr als 200 Millionen Jahren und haben sich über diese Zeitspanne hinweg kaum verändert. Es ist die älteste überlebende Reptilienform auf Erden und somit haben diese aus der Trias stammenden Echsen nicht nur die ganze Jura- sondern ebenfalls die komplette Kreidezeit überlebt. Wenn wir allerdings weiterhin ihren Lebensraum so verschmutzen, könnte es sein, dass sie den Menschen nicht überleben werden.
Emys orbicularis führt eine eher versteckte Lebensweise und hält sich vorwiegend im Wasser auf. Demzufolge ist sie natürlich selten beim Sonnenbaden zu beobachten. In Tarifa sind wir auf „Gewässer“ gestoßen, in denen diese Tiere unter erbärmlichen Konditionen leben oder besser gesagt überleben müssen. Durch das rücksichtslose Verhalten der Menschen müssen diese gepanzerten Echsen ihre Tümpel mit leeren Bierdosen, Plastiktüten und Fäkalien teilen.
Schlangen
Natürlich hielten wir stets Ausschau nach Schlangen. Nach mehreren Tagen stießen wir auf eine interessante Entdeckung, die uns bestätigte, dass Andalusien tatsächlich noch von Vipern bewohnt ist. Wir fanden eine etwa 45 cm lange Haut einer sub-adulten, weiblichen Stülpnasenotter (Viperia latastei gaditana). Diese mittelgroße, kräftige Viper ist leicht an ihrem breiten, deutlich vom Körper abgesetzten dreieckigen Kopf und den senkrechten Pupillen als solche zu erkennen.
Sie hat ein eher ruhiges Wesen und flüchtet meist bei Gefahr. Ein Biss endet für den Menschen normalerweise nicht tödlich und ist nur mit starken Schmerzen verbunden.
Sie meidet von Menschen geformte Kulturlandschaften und fühlt sich nur in gesteinsreichen Gegenden wohl, wo sie überall in Spalten Unterschlupf finden kann.
Durch die Verstädterung, den Straßenbau und die intensive Landwirtschaft, existieren kaum noch ideale Habitate für diese Giftschlange und demzufolge ist sie nur noch sehr selten anzutreffen.
Es blieb jedoch nicht bei dem Fund der Vipernhaut. Zu unserer Freude sind wir schlussendlich auf eine interessante Schlangenart gestoßen: eine etwa 1,4 m lange Eidechsennatter (Malpolon monspessulanus). Es handelt sich hierbei um eine Trugnatter, was bedeutet, dass sie zwei recht kleine Giftzähne besitzt, welche sich relativ hinten im Oberkiefer befinden. Auch wenn kleinere Nager, Vögel und Eidechsen keine Chance gegen sie haben, kann ihr Toxin dem Menschen nicht gefährlich werden.
Sie hält sich vorwiegend in tiefen bis mittleren Lagen auf, wobei sie vor allem trockene und vegetationsreiche Habitate bevorzugt. Der für Nattern typische Körper ist schlank gestaltet und sie kann eine Länge von über 2m erreichen und ist somit die längste in Europa heimische Schlangenart. Ihre Färbung kann ziemlich stark variieren: hell- bis dunkelgrau, olivfarben, schwarz oder rötlich braun mit dunklen oder hell gesäumten Punkten an den Flanken. Somit ist sie perfekt getarnt und für einen Laien kaum auffindbar.
Nach einer kurzen Winterruhe setzt das Weibchen im Hochsommer ein Gelege von etwa 8-20 Eiern im feuchten Bodensubstrat ab. Das Exemplar, das wir unter der Führung unseres Experten Francisco Jiménez Cazalla gefangen haben, war eine wunderschöne und selbstbewusste Dame.
Meeresschildkröten
Die Geschlechterdetermination diverser Reptilien hängt von der Bruttemperatur der Eier ab. Durch den zunehmenden Klimawandel sind die Temperaturen an den Stränden der Kapverdianischen Inseln auf über 30 Grad Celsius angestiegen, was dazu führt, dass fast ausschließlich weibliche Tiere schlüpfen. Ein aufwendiges Aufzuchtprogramm in Südspanien soll nun die Bestände der Unechten Karettschildkröte stützen und dem anstehenden Aussterben entgegenwirken.
Unter der persönlichen Führung des Direktors wurde uns Einblick in eines der größten Aufzuchtzentren Spaniens gewährt und uns wurden die laufenden Projekte genauestens erläutert.
Damit die Geschlechterverteilung der Caretta caretta ausgeglichener ausfällt, werden die Eier künstlich bei kühleren Temperaturen inkubiert. Nachdem die Jungen dann etwa ein Jahr lang in Gefangenschaft aufgezogen wurden, werden sie an Stränden ausgewildert, die zum Schutz der Tiere nicht preisgegeben werden.
Ob diese in Menschenhand aufgezogenen Wildtiere später zur Eiablage an die Strände zurückkehren, wo sie freigelassen wurden, bleibt nur zu hoffen. Denn eigentlich legen Schildkrötenweibchen ihre Eier dort ab, wo sie selbst geschlüpft sind. Vielleicht leitet ihr natürlicher Kompass sie zu den Kapverdianischen Inseln und das Problem mit der Geschlechterverteilung beginnt von vorne. Wissen können wir es erst in einem Vierteljahrhundert und bis dahin können wir nur abwarten.
Der Biologin Rosa Mendoza zufolge, werden diese Meeresschildkröten erst im Alter von 25 Jahren geschlechtsreif, wobei nur ein Tausendstel aller Tiere dieses Alter erreicht. Wenn man jetzt bedenkt, dass von etwa 1000 geschlüpften Tieren mit etwas Glück nur ein einziges, weibliches Exemplar diese Geschlechtsreife erreicht, ist es eigentlich ein Wunder, dass sie überhaupt noch existieren.
Die weltweit größte Schildkröte ist, wenn auch nur äußerst selten, im Atlantik, nahe der Iberischen Halbinsel anzutreffen. Mit einer Carapaxlänge von bis zu 2,5 m und einem Gewicht von bis zu 700 kg ist die Lederschildkröte (Dermochelys cordiacea) die größte Schildkrötenart, die derzeit unseren Planeten bewohnt. Der IUCN zufolge ist sie die am stärksten bedrohte Tierart überhaupt. Obwohl sie im Meer lebt, wird sie offiziell nicht den Meeresschildkröten zugerechnet, da sie einen kompletten Knochenpanzer anstatt eines Rückenschildes besitzt. Dieser ist mit einem verhornten Schuppenhemd bedeckt.
Echsen
Die wohl am häufigsten verbreitete Echsenart auf der Iberischen Halbinsel ist der Spanische Mauergecko (Tarentola mauritanica), den wir in den verschiedensten Lebensräumen aufgefunden haben. Diese Squamata sind nicht nur in Dörfern beheimatet, sondern leben ebenfalls in Gebirgslandschaften, Wäldern und Sanddünen.
Eine weitere, stark verbreitete Echsenart auf der Iberischen Halbinsel ist der bis zu 30 cm lange Algerische Sandläufer (Psammodromus algirus). Zwei Drittel seiner gesamten Körperlänge stellen den Schwanz dar. Die zwei lateral angeordneten Längsstreifen stechen auf der eher dunklen Körperfärbung besonders hervor.
Im Gegensatz zum Spanischen Sandläufer ist der Algerische Sandläufer ein wahrer Kletterkünstler und fühlt sich auch in höher gelegenen Hängen oder kleinen Sträuchern sowie in Olivenbäumen wohl.
Deutlich größer und massiver als die Sandläufer ist die Perleidechse (Timon lepidus). Mit einer Gesamtlänge von bis zu 65 cm ist sie derzeit die größte in Europa heimische Eidechsenart. Die feine netzartige Musterung auf dem wunderschönen leuchtend grünen Körper verleiht dieser Echse ein prachtvolles Aussehen. An den Flanken verlaufen drei bis vier übereinander liegende Reihen kräftiger blauer Flecken mit einer schwarzen Einfassung. Jungtiere dieser Art haben eine ganz andere Rückenzeichnung, die wie Augenflecken aussehen. Dies schützt sie oft vor Feinden, da diese hinter diesen großen Augen keine hilflose Echse erwarten.
Sie steht nicht nur auf der Speisekarte von Zwergadler, Schlangenadler, Habicht und Milan, sondern wird ebenfalls sehr gerne von Schlangen wie der Eidechsennatter (Malpolon monspessulanus) gejagt und gefressen.
Das einzige (adulte) Exemplar das wir angetroffen haben, wurde kurze Zeit vorher von einem Rasenmäher erfasst und erlitt lebensgefährliche Verletzungen im Kopfbereich. Perleidechsen sind sehr sonnenhungrig und ziehen sich nur für die Nacht in ihre selbstgegrabenen Bauten zurück oder verstecken sich in einem Nagerbau sowie in hohlen Baumstämmen. Das von uns gefundene verletzte Tier hatte sein Nachtquartier, laut Aussage der Grundstückbesitzerin, in einem Abflussrohr.
Während Gehör- und Geruchssinn relativ schlecht entwickelt sind, können Chamäleons äußerst gut sehen. Das Auge des Chamäleons ist bei weitem leistungsfähiger als beim Menschen. Sie können mehrere Kilometer weit scharf sehen, was für diese recht langsamen Tiere sehr wichtig für ihr eigenes Überleben ist.
Beide Augen können sich unabhängig voneinander bewegen und somit haben sie ein Sichtfeld von 360°.
Sobald das Chamäleon seine Beute mit einem Auge erblickt hat, wird sie mit beiden Augen fokussiert. Jetzt kommt die Schleuderzunge ins Spiel, mit welcher das Beutetier in nur einem Bruchteil einer Sekunde erfasst wird. Sie besteht aus elastischem Bindegewebe und liegt zusammengezogen auf dem Zungenbein. Kurz vor dem Aufschlagen, bildet die verdickte Zungenspitze einen Saugnapf und somit ein Vakuum. Die Beute hat keine Chance sich aus dem Sog zu befreien. Die Zunge selbst kann das eineinhalbfache der Körperlänge des Tieres erreichen.














Obwohl er nachtaktiv ist, lässt sich dieser 15 cm große Gecko tagsüber vielerorts beim Sonnenbaden beobachten. Auch wenn er auf der Speisekarte vieler größerer Echsenarten, Schlangen, Eulen, Raubvögel und vor allem Katzen steht, kann man jährlich tausende dieser Kaltblüter zählen.
Da dieser Gecko sich in den verschiedensten Habitaten als auch in Menschennähe wohl fühlt, wird er uns hoffentlich noch lange Zeit erhalten bleiben.
Der Spanische Sandläufer (Psammodromus hispanicus) ist hingegen etwas ungeschickter und bevorzugt eher das Flachland. Mit einer Größe von etwa 4 cm Körperlänge ist er nur halb so groß wie sein algerischer Verwandter.

Abgesehen von den Chamäleons, sind alle hier vorgestellten Echsenarten fähig, ihren Schwanz bei Gefahr abzuwerfen. Dieser Schutzmechanismus ermöglicht den Tieren die Ablenkung des Feindes und besten Falls die Flucht.
Leider funktioniert dies nur einmal und so sollte man unbedingt darauf achten, sie richtig zu handhaben. Trotz aller Vorsicht und Erfahrung hielt auch ich unglücklicherweise einen abgeworfenen Schwanz in den Händen.
Für das Tier ist dies sicherlich nicht lebensgefährlich, dennoch wird es durch den nötigen Heilungsprozess geschwächt und hat seinen einzigen, so genannten „Joker“ verloren.


Rana ridibunda © J. Schreiner
Rana perezi © J. Schreiner
Hyla meridionalis © J. Schreiner
Mauremys leprosa © J. Schreiner
Emys orbicularis ssp. © J. S.
Caretta caretta © J. Schreiner
Caretta caretta © J. Schreiner

Psammodromus algirus © Jeffrey Schreiner
Timon lepidus © Jeffrey Schreiner
Chamaeleo chamaeleon © Jeffrey Schreiner
Der massive Rückgang der Bestände von Meeresschildkröten hinterlässt rund um die Küsten Spaniens ihre Spuren. Eine gravierende Folge ist die zunehmende Überbevölkerung von Quallen, welche eigentlich zur Hauptspeise vieler Meeresschildkröten und Thunfischen gehören. Wegen ihres Fleisches, ihrer Eier und des Schildplatts wurde die Unechte Karettschildkröte (Caretta caretta) intensiv gejagt, bis ihre Populationen zusammenbrachen. Noch immer fallen jährlich viele Tiere den Schleppnetzen der Krabbenfischer zum Opfer.
Heute sind beide Unterarten vom Aussterben bedroht und stehen durch das Washingtoner Artenschutz-Übereinkommen unter internationalem Schutz.
Malpolon monspessulanus © Jeffrey Schreiner
Malpolon monspessulanus © J. S.
Malpolon monspessulanus © Jeffrey Schreiner
Tarentola mauritanica © J. S.
Tarentola mauritanica © J. S.
Tarentola mauritanica © J. S.

Ein Bericht von Jeffrey Schreiner mit der Unterstützung vom „Fond National de la Recherche“




Herpetofauna im Süden Spaniens(August 2011 in Tarifa)

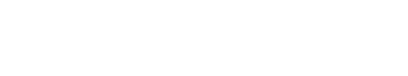

Dank der Terraristik haben diese „Exoten“ in den letzten Jahren einen viel höheren Stellenwert erlangt. Während der schwedische Zoologe Carl von Linné im 18. Jahrhundert noch alle Schuppenkriechtiere als ekelhaft und widerwärtig beschrieb, zeigen immer mehr Menschen Interesse an diesen prachtvollen Geschöpfen.